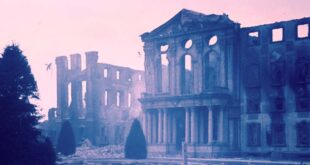Man muss gar nicht so weit schauen, um zu erkennen, dass um uns herum Menschen leben, die einfach großartig und faszinierend sind. Sie sind nicht prominent und stehen in keinem Rampenlicht und trotzdem sind sie einzigartig in dem, was sie tun und was sie erlebt haben. Die Autorin Renate Weilmann und der Fotograf Bernhard Dedera geben in ihrem Buch „spiegelblicke“ Einblicke in das Leben von Menschen unserer Region. Einige davon stellen sie im WILLI vor.
Manfred Jenz, Kunsthandwerker, Bogenbauer, Schreiner, Baurestaurator, Lebenskünstler
Nach Manfred zu fragen ist sinnlos im Flecken. Alle nennen ihn Gigi. Sogar er selbst. Und schuld ist dieser Vogel auf dem Dach seines Elternhauses, das nun von ihm bewohnt wird. Vor über hundert Jahren, im Jahre 1910, breitete sich ein Feuer von hier aus. Es ergriff die Nachbarhäuser und richtete großen Schaden an. Und um solcherlei in Zukunft zu vermeiden, wurde ein Schutzbann in Form eines Hahnes aufs Dach gesetzt. Ein Hahn heißt „Gockel“, hier am Übergang zwischen Kraichgau und Zabergäu, genauer gesagt ein „Gigler“. Und als der kleine Schulbub Manfred einst gefragt wurde, zu welchen der zahlreichen im Ort vertretenen Jenzens er denn gehöre, antwortete er: „Zum Gigler Jenz“, doch weil der Bub so aufgeregt war, wurde aus „Gigler“ „Gi-gi-gi-gler“. So werden Namen geboren. Und Legenden.
Seit dem 16. Jahrhundert hat seine Familie hier gewohnt. Sein Vater ist hier geboren. Seine Eltern seien damals in den 1950ern bereits etwas Besonderes gewesen. Sie pflanzten Rüben, Heu für die Kühe, Kartoffeln, Gemüse, Wein, hielten Schweine, Hühner und allerlei Kleinvieh. Freie Bauern halt, frei vom Druck der Massenproduktion. Und vor dem Haus stand der Misthaufen. Für den sich Klein-Gigi schämte.„Aussiedlerhöfe“ wurden geboren. Gigis Vater entschied sich dagegen. Meine Wurzeln sind hier, sagte er.
„Ich will die Wurzeln meiner Eltern weiter wachsen lassen“, philosophiert Manfred Jenz, „doch oft habe ich auch schon gedacht, ich brauche mehr Platz!“
Heimat sei da, wo die Seele wohnt, sagt einer, der die Heimat nie verlassen hat. Seine Seele wohne hier überall. In der Natur, den Bäumen, kurz gesagt, dort, wo er ist.
Wir trinken Tee in seiner Wohnstube, die gleichzeitig Werkstatt und Mittelpunkt seines Hauses ist. Man merkt diesem Heim an, das es sich mehrfach an sich verändernde Lebenssituationen anpassen musste. Es wirkt wie Matrjoschkas, russische Holzpüppchen, die ineinander verschachtelt, jedes mal eine neue, kleine Überraschung darbieten. Der Bogenbauer erzählt, wie er als Kind seinen Eltern in der Landwirtschaft half, und wie es ihn einschränkte und gleichzeitig bereicherte. Zeit zum Spielen gab es auch und die Plätze seiner Kindheit im Ort blieben in seiner Erinnerung.
Was ihm nicht gefällt, sind Industrieanlagen, Baustellen, Autobahnen. Er sagt es beinahe flüsternd, als sei es ein Frevel, dies laut auszusprechen. Als sei er, wie er es von seinen Eltern seinerzeit dachte, ein Außergewöhnlicher, ein Sonderling, einer, der nicht mehr mitkommt mit der neuen Zeit und ihrer Geschwindigkeit. Einer, der nicht mehr mitkommen möchte, betont er. Der, der noch immer den Misthaufen neben der Haustür hat statt eines großzügigen Gehöftes am Dorfrand. Handwerk sollte im Dorf stattfinden, heutzutage seien Handwerksstätten ausgelagert und den Kindern werde dadurch der Zugang verwehrt.
Manfred Jenz ist freischaffender Kunsthandwerker. Seine handgefertigten Pfeile und Bögen sind weit über die Region hinaus bekannt und geschätzt. Auf Mittelaltermärkten bietet er seine Ware an. Als Zeitreisender fühlt er sich. Und es gefällt ihm.
„Der Holzweg ist ein wichtiger Weg“, philosophiert er mit seinem für ihn so typischen schelmischen Lachen. Vom Holz käme sehr viel, sinniert er. „Wir stehen drauf, wir sitzen drauf, wir schlafen drauf, es versteckt uns und ernährt uns“, zählt Gigi auf, der von sich sagt, er könne sehen, hören, fühlen, ob und wie Holz richtig bearbeitet wird.
„Holz ist kein einfaches Material, es ist so unterschiedlich wie wir Menschen“.
Alles Technische ist nicht seine Ausrichtung. Der Gedanke, dass die Natur wachsen lässt, was man braucht gefällt ihm. Er hat eine ausgeprägte Liebe zur naturgegebenen Form. Und er schildert, wie so ein Bogen entsteht, wie er, der das Holz bearbeitet, bereits Bäume anders sieht, ihren Wuchs, ihre Formen, teils lustige, teils sinnliche, ja sogar erotische. Wenn er die Klinge über das Holz zieht, hört er schon am Klang, wo Unregelmäßigkeiten sind.
„Heimat ist da, wo die Seele wohnt.“
„Es ist eine hohe Kunst, mit Holz so umzugehen, zu erkennen, was man herausholen kann, welchen Belastungen ich es aussetzen kann“, erzählt er strahlend.
„Früher war man ein Teil vom Ganzen“
Gigi braucht es erdig. Ohne technischen Schnickschnack. Nur er und sein Bogen. Ein gewachsenes Stück Holz. Aufrecht stehen, spannen, entspannen, loslassen können, das gibt Struktur. Struktur sei wichtig, nicht nur hierbei. Den Bogen zu überspannen kann einem auch im Leben passieren. In einer Beziehung beispielsweise. „Wenn man die Grenze nicht sieht“, sagt er. Vermisst er die Individualität unter den Menschen? „Nun ja, … überall individuelle Menschen mit individuellen Klingeltönen …“, lautet seine ironische Antwort.
„Wir sind uns heute selbst viel, viel wichtiger. Früher war man ein Teil von dem Ganzen. Der Gedanke gefällt mir!“
Lade dir jemanden Gefährlichen zum Tee ein, soll Beuys gesagt haben, lese ich an Gigis Tür. Umarme Bäume, lerne Schlangen beobachten, pflanze unmögliche Gärten. Werde ein Freund von Freiheit und Unsicherheit.
Schuld an allem ist dieser Vogel. Dieser rote Feuervogel auf dem Dach. In welche Himmelsrichtung schaut er denn nun? Nach Osten Richtung Kraichgau? Nach Westen Richtung Zabergäu? Oder dreht er sich gar heimlich? Des Nachts, wenn alle Katzen grau sind und alle Kürnbacher schlafen? Schaut sich die Welt von oben an? Hüben und drüben. Und er denkt über Gigis Worte nach. Und er hadert damit, hier oben festzusitzen und genießt dennoch den freien Blick bis zum Horizont und darüber hinaus. Und er fragt sich, ob das auch für Gigler gilt, was der Gigi da gesagt hat:
„Wir können zwar vieles, doch dürfen wir auch vieles?“
Text: Renate Weilmann, Bilder: Bernhard Dedera
 Landfunker RegioNews Regioportal für News, Videos & Termine aus Bruchsal, Bretten, Karlsruher Norden
Landfunker RegioNews Regioportal für News, Videos & Termine aus Bruchsal, Bretten, Karlsruher Norden