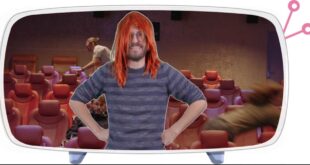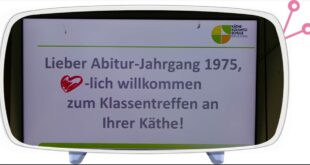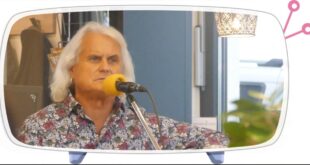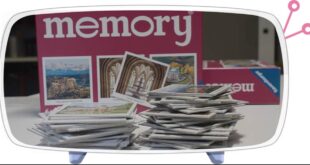Eine besondere Eigenheit des Kraichgauer Humors sind die Ortsneckereien. Fast jedes Dorf im Kraichgau hat seine eigene, meist unverwechselbare Geschichte, die den Bewohnern einen „Uznamen“ eingebracht hat. So werden Leute aus Zeutern auch als „Weinschläuch“ bezeichnet, die Weiherer sind „Schnecke“ und Odenheimer sind auch als „Linsenbäuch“ bekannt.
Kein Ort im Kraichgau identifiziert sich so stark mit der Kirsche wie Unteröwisheim. Sie hat den Bewohnern nicht nur den Spitznamen „Kerschdekipper“ gegeben, sondern auch eine ruhmreiche Vergangenheit. Das Gedicht „Der Lebenslauf einer Kirsche“ von der Ur-Unteröwisheimerin Linda Hettinger gibt uns ein Bild des Geschichtsverlaufes. Es beginnt mit den Zeilen:
„Als sie reif waren, kam der Bauer und probierte.
Er stellte fest, das ist eine ganz besondere Sorte,
sehr edel und fein, die Schwarze Glanzkirsche.“
So ist die Schwarze Glanzkirsche das Symbol Unteröwisheims, mit dem sich das Dorf bis heute identifiziert.

Die Bevölkerung Anfang des 20. Jahrhunderts war arm und schwer gezeichnet vom gerade vergangenen Krieg. Die jährliche Erntezeit brachte den Familien die Haupteinnahmen. Mit Wagen und Leitern ging es auf die Hügel. Auch die Kinder kamen mit und halfen bei der mühsamen Arbeit. Die Eltern stiegen auf die Bäume und brachen die Kirschen.
Als Sammelort diente ein großer, auf dem Rücken getragener Korb. An dieser Stelle definiert sich teilweise die Begriffsherkunft der Bezeichnung „Kerschdekipper“. Für die einen gilt der geflochtene Korb als „Kippe“ und erklärt so die Wortendung „Kipper“. Für Andere ist die Kippe zwar ebenfalls ein Korb, nur eben einer, der ausschließlich bei der Weinlese zum Einsatz kommt. Die originäre Bezeichnung des „Kerschdekorbes“ lautet „Kradde“.
 Landfunker RegioNews Regioportal für News, Videos & Termine aus Bruchsal, Bretten, Karlsruher Norden
Landfunker RegioNews Regioportal für News, Videos & Termine aus Bruchsal, Bretten, Karlsruher Norden