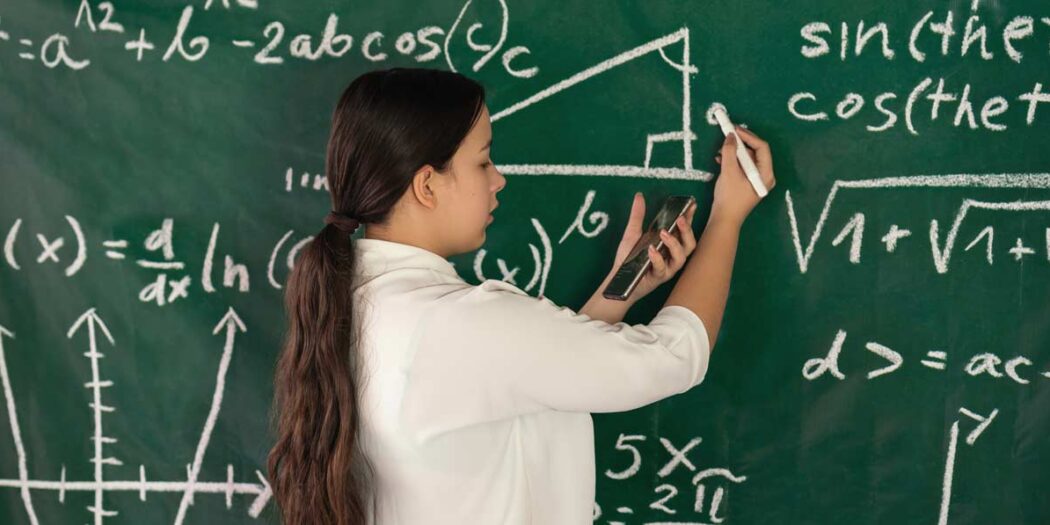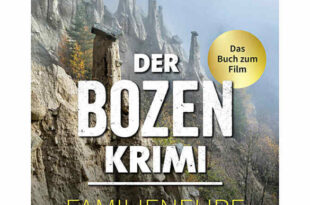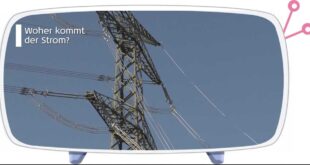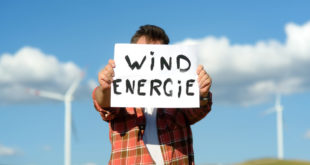Am 13. Januar hat der amtierende Oberbürgermeister von Bretten Martin Wolff überraschend seinen vorzeitigen Ruhestand …
Mehr dazu >>>Neues aus der Region
Unser Zukunfts-Tipp | 20.4.2024 | Ausbildungsmesse „Markt der Berufe“
Ausbildungsmesse „Markt der Berufe“ Samstag, 20.4.2024 10:00 Für Jugendliche, Eltern und Unternehmen auf der Suche …
Mehr dazu >>>Bruchsaler Erstaufnahme für Asylbewerber: Am Weiherberg oder gar in der Südstadt?
Die Debatte um die Erstaufnahme für Asylbewerber in Bruchsal nimmt an Fahrt auf. Die geplante …
Mehr dazu >>>Unser Naturfreunde-Tipp | 19.4.2024 | Wie geht Rehkitzrettung?
Vortrag – Rehkitzrettung mit moderner Technologie Freitag, 19.4.2024 21:00 Einblick in den Einsatz moderner Technologie …
Mehr dazu >>>Unser Bretten-Tipp | 20.4.2024 | Pestführung „Sensenmann und Rattenvolk“
Pestführung „Sensenmann und Rattenvolk“ – Entdecke die Schatten der Vergangenheit Samstag, 20.4.2024 20:00 BRETTEN | …
Mehr dazu >>>Simon Merl über die Gründung der Junge Union Kraichgau
Am 17. März wurde die Junge Union Kraichgau gegründet. Wir haben den Vorsitzenden des neuen …
Mehr dazu >>>Unser Tirili-Tipp | 20.4.2024 | Vogelkundliche Wanderung
Vogelkundliche Wanderung Samstag, 20.4.2024 8:00 Treffpunkt Tourist Information / Haus des Gastes Kraichgaustraße 10, Mingolsheim …
Mehr dazu >>>Unser Krimi-Tipp | 19.4.2024 | „Familienehre“. Der Bozen-Krimi
„Familienehre“. Der Bozen-Krimi in Bruchsal Freitag, 19.4.2024 19:30 Am 19. April findet in der Stadtbibliothek …
Mehr dazu >>>Unser Kleinkunst-Tipp | 20.4.2024 | Großer Kleinkunstabend „Musik, Magie und Witz“
Großer Kleinkunstabend „Musik, Magie und Witz“ Samstag, 20.4.2024 20:00 BAD SCHÖNBORN | Ohrenberghalle Tauchen Sie …
Mehr dazu >>>Auf zum großen Finale: Abiturprüfungen beginnen heute mit Biologie
18.4.2024 | Ab heute, Donnerstag 18.4. beginnt für rund 11.350 Schülerinnen und Schüler aus dem …
Mehr dazu >>>175 Jahre Badische Revolution: Geschichtslesungen im „Geschichtscafe“
Ab 29. Februar | Ein ebenso informatives wie kulturelles Angebot für Geschichtsinteressierte, Kulturliebhaber, und alle, …
Mehr dazu >>>Volksantrag für G9-Abitur scheitert im Stuttgarter Landtag
Die Wiedereinführung des neunjährigen Gymnasiums (G9) in Baden-Württemberg bleibt weiterhin ein kontroverses Thema. Während …
Mehr dazu >>>Bruchsaler Rathaus verwandelt sich in futuristisches Filmset
Junge Visionäre erobern das Bruchsaler Rathaus mit VR-Technologie Rathaus als Schauplatz für technologische Innovation Bruchsal …
Mehr dazu >>>Wie aus einer Bank ein Supermarkt wird: Zeutern bekommt Tante M-Laden
Nahversorgung für Zeutern in Sicht: Tante M eröffnet bald ihre Türen Der Umbau hat gerade …
Mehr dazu >>>STARTSEITE AKTUELLE VIDEOS AKTUELLE NEWS TERMINATOR BLAULICHT STUDIOTALK YOUR JOB-VIDEO
-
Macht langsam: Heute beginnt der „Blitzermarathon“
Beim jährlich stattfindenden Blitzmarathon wird auch dieses Jahr wieder verstärkt geblitzt. Temposünder in Baden-Württemberg sollten …
Mehr dazu >>> -
44.425 Straftaten: Auch in Karlsruhe und dem Landkreis stieg die Kriminalität im Jahr 2023
-
Großeinsatz am Rhein: Suche nach Vermisstem stellte sich als unnötig heraus
-
Heftige Auseinandersetzung: Betrunkener Teenager greift Polizisten in Bruchsal an
-
Brandkatastrophe in Bad Schönborn: Mann stirbt in den Flammen eines Hauses
STARTSEITE AKTUELLE VIDEOS AKTUELLE NEWS TERMINATOR BLAULICHT STUDIOTALK YOUR JOB-VIDEO
-
Obergrombach | Geheimnisvolle Orte: Das Obergrombacher Schloss (Archiv 2017)
Obergrombach +++ Streifzüge | Unsere Region ist voller geheimnisvoller Orte, die es zu entdecken gilt. …
Mehr dazu >>> -
Beruf & Karriere | „Die mit dem Eisbär tanzt“ ist zurück (Archiv 2015)
-
Angelbachtal | Stolzes Alter, große Kunst! (Archivbeitrag)
-
KARLSDORF | Pferde in Not – Das letzte Zuhause bei Karlsdorfs Little Ranch (Archiv 2021)
-
Oberderdingen | Der leuchtende Engel (Archiv 2018)
26.02.2018 | Nicht nur Professor an der Hochschule der Medien in Stuttgart, sondern auch …
Mehr dazu >>> -
SYMPATHISCHE IDEE | Der Bollerwagen als rollende Stadtbibliothek
-
HAUS UND GARTEN | In Bruchsal unter Palmen – Wigbert Bohn
-
WILLI-Reportage | Heimspiel für Wolf E. Rahlfs
-
Bruchsaler Rathaus verwandelt sich in futuristisches Filmset
Junge Visionäre erobern das Bruchsaler Rathaus mit VR-Technologie Rathaus als Schauplatz für technologische Innovation Bruchsal …
Mehr dazu >>> -
Bezahlbarer Führerschein: GTÜ begrüßt Vorstoß der Politik für effizientere Fahrerlaubnisprüfung
-
Ein Tag, der Weichen stellen kann: Die Ausbildungsbörse in Oberderdingen
-
Stellenanzeige | Fit mit Kamera & Schnitt? Komm ins KraichgauTV-Team!
-
Bruchsal | Vom KraichgauTV-Praktikum in die größten Stadien der Welt
-
Bruchsal | Die Sparkasse Kraichgau gehört bundesweit zu den besten Ausbildungsbetrieben 2023
19.02.2024 | Studie des Marktforschungsinstituts SWI Human Resources für das Handelsblatt bestätigt die kontinuierlich hohe …
Mehr dazu >>> -
Wissenswertes über KraichgauTV-Regiofernsehen
-
Stellenanzeige | Fit mit Kamera & Schnitt? Komm ins KraichgauTV-Team!
-
Bruchsal | Vom KraichgauTV-Praktikum in die größten Stadien der Welt
-
PRAKTIKUM JETZT | KraichgauTV sucht Redaktionspraktikant/in (m/w/d)
-
JOBS IM VIDEO | Auszubildende Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d) gesucht
ANZEIGE STELLENANGEBOT Refratechnik Cement GmbH In unserem neuen Job-Video stellen wir uns in schnellen …
Mehr dazu >>> -
JOBS IM VIDEO | Auszubildende Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d) gesucht
-
ROCK THIS JOB | Job-Video-Regional
-
JOBS IM VIDEO | Konstruktionsmechaniker Fachrichtung Schweißen und Brennschneiden (m/w/d) gesucht
-
PRAKTIKUM JETZT | KraichgauTV sucht Redaktionspraktikant/in (m/w/d)
-
ROCK THIS JOB | Job-Video-Regional
Unsere Job-Videos zeigen die Menschen und die Stimmung in Ihrem Unternehmen! Mit einem Job-Video bieten …
Mehr dazu >>> -
Unser Projekt soll ins Fernsehen! | Wie kommt das KraichgauTV-Team zu uns?
-
KraichgauTV-Filmbeiträge auf Ihrer Webseite einbetten! So geht das!
-
ROCK THIS JOB | Job-Videos-Regional
-
Video-Upload fürs Fernsehen …
Du warst bei einem Ereignis dabei und hast Videos davon gemacht? Hier kannst du uns …
Mehr dazu >>> -
Jobs in der Region | Komm als Video-Producer/in zu KraichgauTV!
-
KraichgauTV-Filmbeiträge auf Ihrer Webseite einbetten! So geht das!
-
Freund und WILLI-Wegbegleiter Norbert Kritzer gestorben
-
Akquise – Veranstalterinformationen. Gewinnen von Werbepartnern.
 Landfunker RegioNews Regioportal für News, Videos & Termine aus Bruchsal, Bretten, Karlsruher Norden
Landfunker RegioNews Regioportal für News, Videos & Termine aus Bruchsal, Bretten, Karlsruher Norden